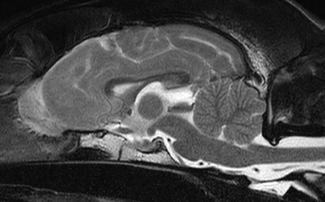Einleitung
Ein Einfluss der Darmmikrobiota auf Gesundheit, Verhalten und kognitive Funktionen durch die Produktion von Metaboliten, Hormonen und Immunfaktoren konnte bereits aufgezeigt werden. Einige Darmbakterien können beispielsweise direkt inhibitorische Neurotransmitter, die die Blut-Hirn-Schranke passieren können, sowie kurzkettige Fettsäuren, die zur Aufrechterhaltung der Blut-Hirn-Schranke und der Regulation von Neurotransmittern beitragen, produzieren. Der Aufbau und die Zusammensetzung des Darmmikrobioms im Zusammenhang mit Epilepsie wurden bislang noch nicht eingehender analysiert, es gibt aber Hinweise darauf, dass Darmbakterien einen Einfluss auf die Kontrolle von Anfällen haben könnten. Ziel dieser Studie war es, die Veränderungen des Darmmikrobioms in Verbindung mit kaniner idiopathischer Epilepsie und den möglichen Einfluss von Antiepileptika auf die Zusammensetzung des Mikrobioms zu untersuchen.
Material und Methoden
Top Job:
Die Zusammensetzung der fäkalen Mikrobiota wurde mittels Gensequenzierung des bakteriellen 16S-rRNA-Gens in einer Gruppe gesunder Kontrollhunde (n = 12) und einer Gruppe Hunde mit Epilepsie vor (n = 10) und nach einer 30-tägigen Monotherapie mit Phenobarbital oder Imepitoin (n = 9) analysiert.
Ergebnisse
Firmicutes, Bacteriodetes, Fusobakterien, Proteobakterien und Actinobakterien waren sowohl in der gesunden Kontrollgruppe als auch in der Gruppe von Hunden mit Epilepsie die vorherrschenden Bakterienstämme in der Analyse der fäkalen Mikrobiota, wobei Clostridien und Clostridiales die in beiden Gruppen dominierende Bakterienklasse beziehungsweise -ordnung, gefolgt von Fusobakterien respektive Fusobacteriales und Bacteroidia respektive Bacteroidales, waren.
Hunde mit Epilepsie wiesen im Vergleich zu den gesunden Kontrollhunden einen signifikant reduzierten Anteil von GABA- (Pseudomonadales, Pseudomonadaceae, Pseudomonas und Pseudomonas graminis) und SCFA-produzierenden Bakterien (Peptococcaceae, Ruminococcaceae und Anaerotruncus) sowie von Bakterien, die mit einer Reduktion für das Risiko von Hirnerkrankungen in Verbindung gebracht werden konnten (Prevotellaceae), auf. Pseudomonaden können aus Glutamat GABA synthetisieren. Eine Reduktion der Pseudomonadenpopulationen führt so vermutlich zu einer verminderten Verfügbarkeit von GABA, einem essenziellen Neurotransmitter zur Anfallskontrolle, im zentralen Nervensystem. GABA selbst könnte wiederum über die Darm-Hirn-Achse regulierende Effekte auf die Pseudomonadenpopulation im Gastrointestinaltrakt ausüben. Ruminococcaceae und Peptococcaceae wiederum können kurzkettige Fettsäuren produzieren, welche die Blut-Hirn-Schranke passieren und im Hypothalamus zur Regulation von Neurotransmittern beitragen. Ein ausreichender Anteil von Prevotellaceae am Darmmikrobiom konnte beim Hund mit einem reduzierten Risiko für immunmediierte Gehirnerkrankungen in Verbindung gebracht werden.
Des Weiteren konnten Unterschiede in den Anteilen von Anaerotruncus und Lactobacillus beobachtet werden, ihre genaue Rolle in der Darm-Hirn-Achse bleibt zum jetzigen Zeitpunkt unklar.
Die 30-tägige Gabe von Antiepileptika zeigte keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Darmmikrobioms.
Schlussfolgerung und klinische Relevanz
Diese Ergebnisse tragen zum Verständnis des Erkrankungsbildes der kaninen idiopathischen Epilepsie bei. Sie schaffen die Möglichkeit zur Untersuchung neuer therapeutischer Ansätze, einschließlich der Gabe von Probiotika zur Wiederherstellung des Darmmikrobioms bei Hunden mit Epilepsie. Insbesondere die Rolle der Produktion von Neurotransmittern durch Darmmikrobiota und die Synthese kurzkettiger Fettsäuren mit direkter regulierender Wirkung auf
Neurotransmitter liefern einen Ansatz für weitere Studien. Die Rolle anderer Bakteriengruppen in der Darm-Hirn-Achse bedarf weiterer Untersuchungen. Die Behandlung mit Antiepileptika zeigte keine Auswirkung auf die Zusammensetzung des Darmmikrobioms.
Originalpublikation:
García-Belenguer S, Grasa L, Valero O, Palacio J, Luño I, Rosado B (2021): Gut Microbiota in Canine Idiopathic Epilepsy: Effects of Disease and Treatment. Animals 11(11): 3121.
doi.org/10.3390/ani11113121.